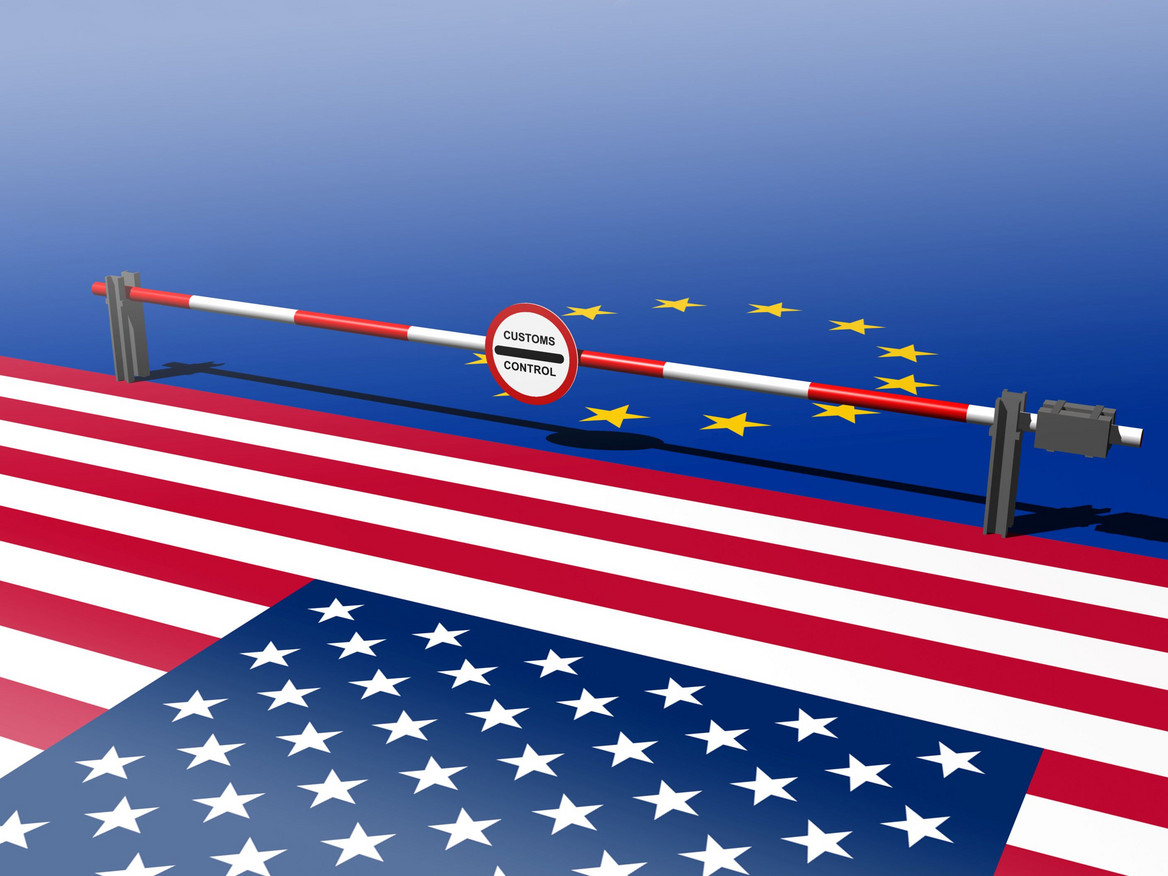Der Fortschritt bei Boehringer Ingelheim ist so bemerkenswert, dass in diesem Sommer selbst Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck zu Besuch kam. Der Pharmakonzern hat sein Biomasseheizkraftwerk in Betrieb genommen – und das sorgt für gewaltige Veränderungen. Pro Jahr werden rund 50.000 Tonnen Treibhausgas (CO2) eingespart. Fast den kompletten Energiebedarf am Standort kann das Unternehmen künftig aus erneuerbaren Quellen decken. Für Habeck ist das ein gutes Beispiel dafür, wie sich globale Klimaziele erreichen und Energieimporte verringern lassen.
Klimaneutral werden bis 2045, das müssen Deutschland und die hiesige Chemie- und Pharmaindustrie schaffen. Das heißt: Sie müssen ihre Treibhausgasemissionen, insbesondere den CO2-Ausstoß auf null reduzieren, die Emission kompensieren oder das CO2 abtrennen und unterirdisch speichern, sodass es nicht wieder in die Atmosphäre gelangt. So sieht es das Klimaschutzgesetz der Bundesregierung vor.
Auf diesem Weg haben die Unternehmen bereits große Fortschritte erzielt – und zwar nicht nur Konzerne wie Boehringer Ingelheim, sondern auch kleine und mittelständische Betriebe. Der CO2-Ausstoß der Branche ist massiv zurückgegangen: von mehr als 65 Millionen Tonnen im Jahr 1990 auf 38,9 Millionen im Jahr 2020. Und das, obwohl die Produktionsmengen im selben Zeitraum um 61 Prozent gestiegen sind. Das zeigen Zahlen des Verbands der Chemischen Industrie (VCI).
profine: Kiefernöl statt Erdöl
Grundsätzlich gibt es mehrere Möglichkeiten, um den CO2-Ausstoß in der Chemieindustrie zu reduzieren. Zwei der wichtigsten Hebel: erstens, die Energiequelle umzustellen – also auf erneuerbare Quellen wie Sonne, Wind oder Biomasse zu setzen statt auf fossile wie Kohle, Gas oder Öl. Und zweitens, andere Rohstoffe in der Produktion zu nutzen. Neben Recycling und dem Einsatz von CO2 gibt es hier Potenzial, grüne Alternativen wie Pflanzen oder Biokunststoffe zu nutzen.
Das gilt etwa für den Kunststoffspezialisten profine aus Pirmasens. Ein wichtiger Baustein für dessen Fensterprofile ist Ethylen. Klassischerweise basiert das auf fossilen Materialien. Das Unternehmen hat es aber geschafft, teilweise auf Ethylen aus dem nachwachsenden Rohstoff Kiefernöl umzusteigen. Das macht es möglich, nachhaltiger zu bauen und zu renovieren. Auch das Familienunternehmen RENOLIT bietet nachhaltige Kunststoffprodukte an, die einen hohen Rezyklatanteil haben, zu 100 Prozent recycelbar sind oder teilweise aus nachwachsenden Rohstoffen bestehen. Ein Beispiel sind Verbundplatten zur Herstellung von Innenverkleidungen im Automotivebereich, die mindestens 50 Prozent nachwachsende Naturfasern enthalten.
Und Lohmann aus Neuwied stellt unter anderem Klebstoffe her, die zu 50 Prozent biobasiert sind. Die Prozesse wurden so umgestellt, dass deutlich weniger Energie verbraucht wird. Lohmann stehe an einem entscheidenden Wendepunkt, erklärt Katharina Candia Avendaño, weltweit zuständig für Nachhaltigkeit, auf der Webseite des Unternehmens. Die Branche stehe vor Krisen, die zentrale Entscheidungen für ihre Zukunftsfähigkeit und nachhaltige Entwicklung erforderten. „In diesem Zusammenhang hat Lohmann erhebliche Investitionen in nachhaltigere Innovationen getätigt.“ Das Unternehmen trage zur Kreislaufwirtschaft bei und entwickle das interne Know-how weiter.
Grüne Energie: Versorgung zu unsicher?
Für die Branche insgesamt gilt allerdings: Allein kann sie das Ziel der Klimaneutralität nicht erreichen. Selbst wenn die Unternehmen alle Möglichkeiten ausreizen, Prozesse umzustellen, genügt das nicht. Sie sind von äußeren Faktoren abhängig – etwa von der öffentlichen Infrastruktur, von der Verfügbarkeit und den Kosten CO2-armer Energie. „Es sind momentan nicht alle Rahmenbedingungen gegeben, damit die grüne Transformation gelingen kann“, sagt Matthias Belitz, Bereichsleiter für Nachhaltigkeit, Energie und Klimaschutz beim VCI.
Ein gutes Beispiel ist der Strombedarf. Bei den Unternehmen wird er massiv steigen, wenn Prozesse ohne fossile Energien auskommen sollen. Doch bislang gibt es nicht genug grünen Strom. Im ersten Halbjahr 2024 wurden knapp 58 Prozent des deutschen Strombedarfs aus erneuerbaren Energien gedeckt, meldete der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW). Und der Bau der Stromtrassen, über die zum Beispiel Windenergie aus dem Norden zu Industriebetrieben im Süden Deutschlands gelangen soll, kommt nur langsam voran. Ähnliche Hürden gibt es bei Wasserstoff, dem großen Hoffnungsträger der Energiewende (s. Seite 22).
Ohnehin hat ein System, das in weiten Teilen auf Wind und Sonne beruht, Schwächen. „Zur Tagesmitte sind erneuerbare Energien in ausreichendem Maß verfügbar, vor allem durch Solaranlagen”, sagt VCI-Bereichsleiter Belitz. Anders ist es nachts und in Zeiten mit wenig Wind. Kohle- und Gaskraftwerke hingegen liefern konstant Energie. „Durch die Abschaltung der Kohlekraftwerke wird die Erzeugung volatiler“, erklärt Belitz.
Dafür hat die Bundesregierung zwar eine Reserve vorgesehen: Sie will 12,5 Gigawatt Leistung hinzufügen – hauptsächlich durch Neubau, aber auch durch die Modernisierung von Bestandsanlagen. Doch der VCI findet das nicht ausreichend. Die vorgesehenen Kapazitäten sind zu gering. Und es dauere zu lange, bis die Kraftwerke, die perspektivisch mit Wasserstoff laufen könnten, in Betrieb gehen.
Hohe Kosten, erste Schließungen: Was lässt sich tun?
Auch die Kosten sind ein Problem. Schon jetzt zahlen Unternehmen in Deutschland viel mehr für Energie als in China oder den USA. Steuern und vor allem Netzentgelte treiben die Preise hierzulande in die Höhe.
Das bringt die Unternehmen immer mehr unter Druck. Denn ausländische Wettbewerber, die zu geringeren Kosten produzieren, können ihre Produkte in Deutschland und Europa so günstiger anbieten als die heimischen Betriebe. Und für diese wird es gleichzeitig schwieriger, auf anderen Märkten konkurrenzfähig zu bleiben – ein großes Problem für die bislang sehr exportstarke Chemie- und Pharmaindustrie. Sparprogramme und erste Anlagenschließungen sind die Folge.
Was braucht es also, damit die Branche die Wende bis 2045 erfolgreich schafft? Die Kosten für alles, was den klimaneutralen Umbau der Betriebe hemmt, müssten dringend sinken, sagt Belitz. Vor allem Gaspreise, Strompreise und netzausbaubedingte Systemkosten wie Netzentgelte. Und zwar auf Dauer, sodass die Unternehmen Planungssicherheit haben. Zusätzlich müssten die geplanten Backup-Kraftwerke zügig gebaut und eine umfassende Strategie entwickelt werden, um Strom zu speichern. Der Umbau der Branche kann mit voller Kraft weitergehen – wenn es wettbewerbsfähige Kosten und Versorgungssicherheit gibt.
Diesen Artikel gibt es auch in Englisch.